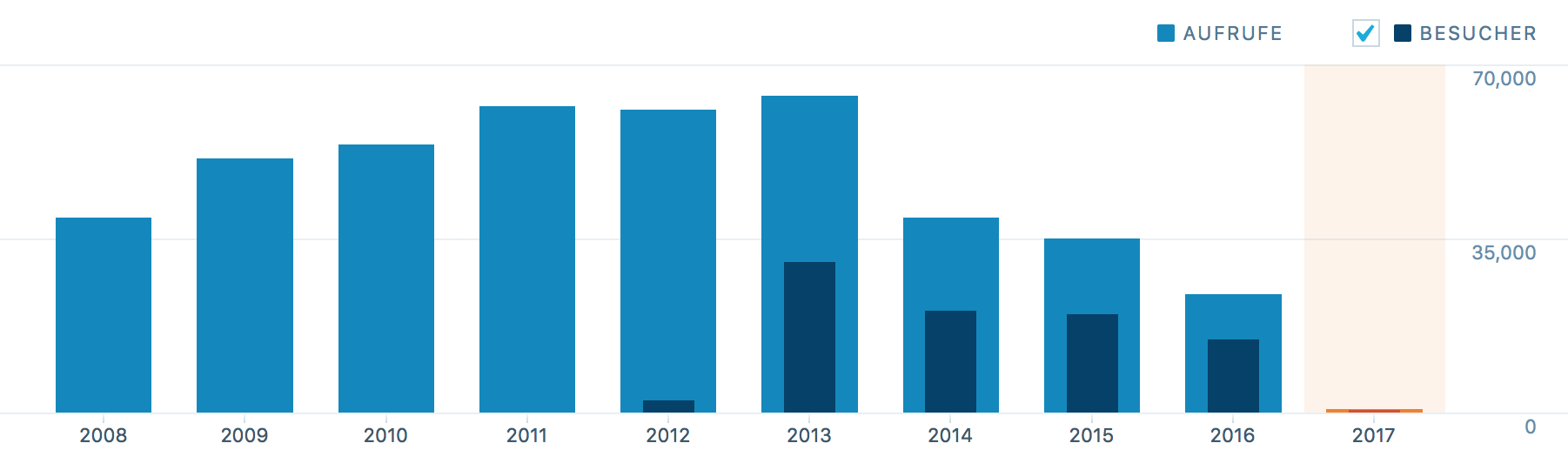Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Gastbeitrag von Michael Gieding. Micha ist ein Kollege an der PH Heidelberg, mit dem ich oft intensive Diskussionen über die Methode Flipped Classroom führe. Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine Kritik des Flipped Classroom, die ich hier gerne veröffentliche. Ich freue mich auf die Diskussion in den Kommentaren.
Prolog: Nürnberg
Nürnberg ist bekannt für seine Rostbratwürste:

Foto von Schlurcher / CC-BY-3.0 & GDFL 1.2
Nur Würste, die im Stadtgebiet von Nürnberg nach einer bestimmten Rezeptur produziert werden, dürfen die Bezeichnung „Original Nürnberger Rostbratwurst“ bzw. “ Nürnberger Bratwurst“ tragen, welche als Herkunftsbezeichnung durch die EU geschützt ist. Spricht man in einem Grillkontext von „Nürnbergern“, weiß jeder Bescheid: Korrekt gegrillt werden sie auf Buchenholz. Nur Banausen verwenden Holzkohle oder braten die „Nürnberger“ gar in der Pfanne. Man kann sagen, dass „Nürnberger“ ein Erfolgskonzept ist. Aus diesem Grunde steht das Rezept ihrer Herstellung fest und wird nicht mehr geändert. Was gut ist bleibt gut.
Weniger erfolgreich gestaltet sich eine pädagogische Fiktion aus Nürnberg, der sogenannte Nürnberger Trichter:
„Fehlt dir’s an Weisheit in manchen Dingen, lass dir von Nürnberg den Trichter bringen.“

von Unbekannt / gemeinfrei
Der Begriff „Nürnberger Trichter“ geht auf den Nürnberger Dichter Georg Philipp Harsdörffer (1607–1658) zurück. Er war der Meinung, dass Poesie gelernt und gelehrt werden könne, ohne dass man hierfür die lateinische Sprache verwenden müsse. Seine Gedanken fasste er in einem Buch mit dem Titel „Poetischer Trichter“ zusammen.
Heute verbindet man mit dem geflügelten Wort des „Nürnberger Trichters“ eher die Idee, jedem möglichst ohne großen Aufwand, quasi durch Handauflegen, effizient etwas beizubringen. Was das „Perpetuum Mobile“ für den Physiker ist der „Nürnberger Trichter“ für den Pädagogen. Man weiß seit langem, dass es kein Perpetuum Mobile geben kann. Selbiges gilt für die Wissensvermittlungsmaschine „Nürnberger Trichter“. Eigentlich wissen das Pädagogen, Didaktiker und Lehrer auch.
Flipped Classroom im Kontext der vorliegenden Ausführungen
„Möchtest Du in einer spiegelbildlichen Welt leben, Kitty? Vielleicht würdest Du dort keine Milch bekommen können oder die Spiegelbildmilch würde Dir nicht schmecken.“
Alice (Aus „Allice im Wunderland“ von Lewis Carroll)
Klassischer Mathematikunterricht sieht in der Regel so aus, dass die Lehrperson zunächst 10 bis 20 Minuten einen Input in Form eines Lehrervortrages gibt um danach mehr oder weniger komplexe Aufgabenblätter zu verteilen, die von den Schülerinnen und Schülern erwarten, dass sie das im Lehrervortrag Gehörte zur Anwendung bringen. Eine weitere Übungsphase wird dann als sogenannte Hausaufgaben in den häuslichen Bereich der Schülerinnen und Schüler verlagert.
Eine „modernere“ Variante dieser Unterrichtsgestaltung besteht darin, die Inputphase in den häuslichen Bereich auszulagern, um in der Schule nur noch zu üben. Per Video schauen sich die Schülerinnen und Schüler jetzt den Lehrervortag zu einem individuell von ihnen gewählten Zeitpunkt zu Hause an, um mit dem somit vorab erworbenen Wissen zum Üben in die Schule zu kommen.
Die Vorteile liegen auf der Hand, die Schülerinnen und Schüler können dem Lehrervortag in dem ihnen jeweils angemessenen Tempo folgen, sollten sie etwas nicht verstanden haben, spulen sie einfach zurück und hören sich den unverstandenen Teil des Vortrages noch einmal an:
WIEDERHOLE
höre dem Lehrer zu
BIS verstanden
Im Gegenzug wird die Übungsphase in der Schule ausgedehnt, was den Vorteil mit sich bringt, dass die Lehrperson mehr Schülerinnen und Schüler individuell beim Üben unterstützen kann.
Ganz nebenbei hat man auch die Digitalisierung mit im Boot der Unterrichtsgestaltung. Moderner geht es nicht!
Die folgenden Ausführungen beziehen sich explizit auf den Mathematikunterricht allgemeinbildender Schulen und dort insbesondere auf die Sekundarstufe 1. Zur Sinnhaftigkeit des Prinzips Flipped Classroom in Bezug auf andere Unterrichtsfächer wie etwa Geschichte will der Autor nichts sagen. Selbiges gilt für die Mathematikausbildung an Universitäten und Hochschulen.
Erklärmirnix als Unterrichtsprinzip
Wie vorab erläutert unterscheidet sich ein Unterricht nach dem Prinzip FC und einem traditionellen Unterricht mit Lehrervortrag nur durch die Auslagerung des Vortrages in den außerunterrichtlichen Bereich der Schülerinnen und Schüler. Aus theoretischer Sicht kann dieses Auslagern gewisse Vorteile für den Lernprozess mit sich bringen. Warum sollte man diesen mehr oder weniger unkreativen Bereich der Wissensaufnahme nicht auch in den außerschulischen Bereich verlagern? Jede Lehrperson, die während eines Vortrages den Zuhörerinnen und Zuhörern in die Augen schaut, wird wissen, dass gerade eine solche Phase Gift für einen guten Unterricht ist: „Wenn alles schläft und einer spricht, dann haben wir gerade Matheunterricht.“
Nun wären viele Kolleginnen und Kollegen schon zufrieden, wenn bei ihrem Vortrage Ruhe herrscht, in der Realität wird jeder Vortrag von regelmäßigen Unterbrechungen begleitet, „Sitz still, hör zu, denk mit!“. Vielleicht ist aber auch der Vortrag nicht das geeignete Mittel der Wissensvermittlung bezüglich der Mathematik? Der Autor wird im Folgenden zumindest für gern gewählte mathematische Unterrichtsvortragsthemen zeigen, dass Vorträge das falsche Mittel bezüglich der Vermittlung von Wissen und Können zu diesen Themen im Kontext der allgemeinbildenden Schule sind.
Ohne den Einspruch seiner Mutter wäre der Autor dieser Zeilen nicht Lehrer für Mathematik und Physik, sondern für Deutsch und Geschichte geworden. Die Mutter des Autors ist Lehrerin für letztere Fächer und warnte ihren Sohn: mach lieber Mathe, unterrichtet sich einfacher und mit weniger Aufwand. Danke Mutter, du hattest Recht.
Mathematik ist wohl das Fach, das sich am einfachsten unterrichten lässt!
Der Grund dafür: Mit vergleichsweise geringem Aufwand lassen sich sehr schnell geeignete Schülertätigkeiten generieren, mittels derer die Schülerinnen und Schüler sich selbst mit dem Unterrichtsgegenstand auseinandersetzen. Nichts ist einfacher, als im Mathematikunterricht den Schülerinnen und Schülern Erfolgserlebnisse zu verschaffen! Beachte nur ein grundlegendes Prinzip: Halte keine Vorträge und organisiere so viele Schülertätigkeiten wie möglich. Die Kunst besteht nur darin, das momentane Leistungsvermögen deiner Schülerinnen und Schüler zu treffen und dann nicht zu vergessen, sie für ihr Engagement zu loben. Schaut mal: Das habt Ihr alleine herausgefunden.
Real existierender Mathematikunterricht sieht in der Regel anders aus. Bei seinen Unterrichtsbesuchen im Rahmen der Praktikumsbetreuung von angehenden Mathematiklehrerinnen und –lehrern sind die Schülerinnen und Schüler von den 45 Minuten einer Unterrichtsunde geschätzte 10 Minuten wirklich selbst aktiv (Sekundarstufe 1, Real- und Werkrealschulen in BW). Den Rest der Zeit lassen sie sich irgendwie berieseln oder sind mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, die nichts mit dem Unterricht zu tun haben. Die Effizienz dieses Unterrichtes geht gegen Null.
Natürlich ist es jetzt naheliegend, den Teil des Unterrichts auszulagern, der offenbar Tätigkeiten nur in begrenztem Maße zulässt: Der Vortrag des Lehrers.
Was aber, wenn die Idee etwas vorzutragen bezüglich der Vermittlung von Mathematik im Rahmen allgemeinbildender Schulen schon das Problem ist? Kann ich Mathematik eigentlich erklären? Nun, bei ganz einfachen Kontexten sollte das wohl sinnvoll und möglich sein. Erklärungen sind doch wohl sicherlich dort nötig und sinnvoll, wo es um Definitionen geht: Eine Raute ist ein Vierecke mit vier gleichlangen Seiten. Muss man doch sagen und erklären, ODER?
Erklärmirnix: Begriffe
Wichtige Begriffe, mit denen die Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht vertraut werden sind etwa: Zahl, Primzahl, gerade Zahl, ungerade Zahl, Quadrat, parallel, senkrecht, Raute, gleichschenkliges Dreieck, größter gemeinsamer Teiler, kleinstes gemeinsames Vielfaches , Kegel, Volumen, Flächeninhalt. Einige Begriffe werden geklärt, andere auf einer gewissen intuitiven Stufe verwendet. In der Regel läuft das so ab, dass die Lehrperson einen Prototypen eines Begriffsrepräsentanten mitbringt und den Schülerinnen und Schülern erklärt, dass sowas etwa Quadrat heißt und diese und jene Eigenschaften hat. Zum Schluss kommt eine Definition ins Merkheft: Ein Quadrat ist ein Rechteck mit gleichlangen Seiten. LERNEN!
Schauen wir uns mathematische Begriffe mal genauer an. Was ist eigentlich ein mathematischer Begriff? Machen wir es konkret mit dem Begriff des Trapezes. Bezüglich der Klärung, was ein Trapez ist, gehen wir von einer gewissen bezüglich der Begriffsbildung relevanten Ausgangsmenge aus, etwa von der Menge aller Vierecke. (Natürlich könnten wir auch von der Menge aller Mengen ausgehen, aber dass die Betrachtung aller Zapfsäulen jetzt eher irrelevant ist, dürfte klar sein.) Diese Ausgangsmenge wird nun in genau zwei disjunkte Teilmengen eingeteilt, deren Vereinigung wiederum die Menge aller Vierecke ergeben: Trapeze und nicht Trapeze.
Für ein grundlegendes Verständnis der Schülerinnen und Schüler für den Begriff des Trapezes brauchen wir jetzt viele Repräsentanten und viele Gegenrepräsentanten des Begriffs. Trapeze die jeder Schüler gleich als Trapez einordnen wird wie etwa die gleichschenkligen Trapeze. Trapeze, die man recht bald als Trapeze identifizieren wird. Spezialfälle wie Parallelogramme, Rechtecke, Rauten und Quadrate. Trapeze, die komisch aussehen, wie etwa ganz lang und ganz platt. Und vor allem Gegenbeispiele wie allgemeine Drachen oder nicht konvexe Vierecke. Die Gegenbeispiele sind dabei oft noch wichtiger als Beispiele, weil sie den Begriff hinreichend abgrenzen. Bis dahin und nicht weiter. Dementsprechend brauchen wir Beispiele, die „komisch“ in der Ebene liegen, und Gegenbeispiele, die fast schon ein Trapez sind. Und wir brauchen den Prozess des Ordnens, des Klassifizierens. Liebe Freunde des guten Unterrichts, wollt ihr diesen Prozess durch einen Vortrag illustrieren oder die Schülerinnen und Schüler lieber selbst durchführen lassen? Der Autor sagt: Mittendrin, statt nur dabei (Sport1).
Die Zerlegung einer Menge M in nichtleereTeilmengen, die zueinander jeweils disjunkt sind und deren Vereinigungsmenge wiederum M ist, nennt der Mathematiker eine Klasseneinteilung. Die Idee der Klasseneinteilung ist einer der zentralsten Begriffe der Mathematik u.a. eine Grundlage der Bildung von Begriffen. Begriffsbildung ist die Generierung einer zweilelementigen Klasseneinteilung auf einer gewissen Grundmenge. Der Begriff des Trapezes ist zunächst nichts anderes als die Klasse besonderer Vierecke, die wir irgendwann dann als Trapez bezeichnen und von den übrigen Vierecken abgrenzen werden. Die Bezeichnung selbst ist Tradition, prinzipiell hätten die Dinger auch Lisa-Schultze-Vierecke heißen können. Begriffsbezeichnungen sind damit Bezeichnungen für Äquivalenzklassen. Die Begriffsbildung selbst ist ein Abstraktionsprozess. Am Ende dieses Prozesses steht eine Bezeichnung, mit der man ein Begriffsverständnis verbindet. Ein Verständnis für den Begriff zu erwerben, heißt diesen Abstraktionsprozess in gewisser Weise nachzuvollziehen. Es ist nicht die Logik, die die Mathematik so schwierig macht, sondern ihre Abstraktheit. Ein Verständnis für einen abstrakten Begriff zu erwerben ist nur durch das eigene Nachvollziehen des Prozesses der Begriffsbildung möglich. Alles andere generiert gefährliches Halbwissen. Nun kann ich Prozesse im Vortrag darstellen, Verständnis wird man nur bei wenigen der Schülerinnen und Schüler vermitteln können, insbesondere dann, wenn das abstrakte Denkvermögen bei den Schülerinnen und Schülern auf der S1 aus entwicklungspsychologischer Sicht noch nicht hinreichend ausgebildet ist.
Die eigene Auseinandersetzung mit dem Gegenstand ist immer sinnvoller, als sich etwas zu dem Gegenstand anzusehen oder nur anzuhören. Im Matheunterricht haben unsere Schülerinnen und Schüler so vielfältige Möglichkeiten selbst tätig zu werden. Sie können Trapeze legen, falten, nachzeichnen, auf Kästchenpapier Vierecke zum Trapez ergänzen … . Wir können ihnen natürlich auch ein Video zeigen:
Liebe Schülerinnen und Schüler, hier ist wieder euer Lehrer mit einem Video. Ihr wisst ja Videos sind gut fürs Lernen. Heute: Trapeze! Gaaaaanz wichtig für die Klausur. Ich hab euch hier eins mitgebracht. Seht ihr, zwei parallele Seiten! Alle Trapeze haben zwei parallele Seiten. Jetzt macht ihr Stop und schreibt auf „Ein Trapez hat …“. …
Da bin ich wieder. Na, habt ihr es richtig geschrieben, ja natürlich, ein Trapez hat zwei parallele Seiten. Das müsst ihr in der Klausur wissen! Lernen!!!! Jetzt zeige ich euch noch wie eine Trapez gezeichnet wird. Das müsst ihr dann auch können in der Klausur. Also aufpassen: …
Und denkt dran, wenn ihr was nicht verstanden habt, wir haben jetzt ja mit den Videos eine Lernmaschine. Einfach nochmal anschauen, solange bis ihr es verstanden habt.
Leser, die glauben, solche Videos gibt es nicht, schauen sich sich die Mathevideos der Apologeten des FC an. Da fragt man sich, wieviel haben diese jungen Lehrer von Mathematikdidaktik verstanden. Dem Autor dienen diese Videos in Didaktikveranstaltungen als Gegenbeispiele für guten Matheunterricht.
Erkärmirnix: Immer dasselbe
Als große Innovation des FC wird hervorgehoben, dass die Schülerinnen und Schüler die Erklärvideos ja solange sich anschauen könnten, bis sie den jeweiligen Kontext verstanden hätten. In der Regel wird es aber so sein, dass Lisa den Stoff auf die dargestellte Weise einfach nicht kapiert. Mehmet kommt mit der Wortwahl im Video nicht zurecht, bei solchen Worten hat er immer ein ungutes Gefühl. Klaus hat Probleme, das Quadrat, das nach seiner Meinung wie eine Raute aussieht, als Quadrat anzuerkennen. … Schau es dir einfach noch mal an und hör gut zu! Da lassen wir junge Menschen immer wieder gegen die Wand rennen … . Klar, klären wir das dann auf, aber wann. Davor hatten Lisa, Mehmet und Klaus wieder einmal ein Misserfolgserlebnis, naja sie kennen das ja schon. Klar helfen bei ihnen dann die hochgelobten modernen digitalen Videos auch nicht, sie haben halt kein Verständnis für Mathematik.
Hinzu kommen die realen Videos des real existierenden FC. Liebe Freunde des guten Unterrichts, mit diesen Videos ist der Misserfolg für viele Schülerinnen und Schüler vorprogrammiert, mit den Videos kann man Mathematik nicht verstehen. Lasst die Dinger weg und fangt gleich an zu üben, wird einfacher.
Erklärmirnix: Nachhaltigkeit
Eines der grundlegenden Prinzipien des Unterrichtens von Mathematik besteht darin, dass sich einer Erarbeitungsphase immer und zwar wirklich immer und das ohne jede Ausnahme eine Erstfestigungphase anschließen muss. Wer etwa mit der Formulierung des Satzes von Pythagoras seine Unterrichtsstunde beendet, hat nicht verstanden, wie die Vermittlung mathematischen Wissens und Könnens funktioniert. Ohne Erstfestigung fängst du in der nächsten Stunde noch mal an. Das heißt spätestens nach einer halben Stunde des Unterrichts solltest du die Neuerarbeitung hinter dir haben, jetzt muss sich in jedem Fall eine betreute Übungsphase anschließen. Gehe immer davon aus, dass eine Mehrheit deiner Schülerinnen und Schüler nach der Erarbeitung des neuen Stoffs ein gewisses Gefühl für das Neue entwickelt haben, aber da fehlt es an Komplexität, da fehlt es an tieferem Verständnis, da hast du gefährliches Halbwissen mehr noch nicht. Es dabei zu belassen ist fahrlässig. Du hättest dir die Neuerarbeitung klemmen können und besser die schriftliche Division üben lassen können. Probiert es aus: Quadrat wurde wieder einmal eingeführt (Spiralprinzip des MU): Zeigt das Logo vom HSV (Die Raute im Herzen ist ein Quadrat auf einer Ecke.) Schüler: Raute, kein Quadrat.
Noch einmal, weil es so wichtig ist! Auf jede Erarbeitung folgt eine Erstfestigung. Immer, ohne Ausnahme! Alles andere ist sinnlos.
Jetzt schauen wir uns den FC an. Natürlich könnt ihr den Schülern nach dem Video noch ein paar Aufgaben geben. Jeder, der hinreichend mit dem Matheunterricht vertraut ist, weiß, dass die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler diese Aufgaben nicht lösen werden. Da ist jetzt ein Hauch von Verständnis bei den Rezipienten der Videos. Bitte bleibt doch in der Realität. Ihr zeigt ein Video, dass die Schülerinnen und Schüler nur halb verstehen und jetzt kommen unbetreute Aufgaben. Mehr könnt ihr die Schülerinnen und Schüler nicht vor den Kopf stoßen. Mit den Aufgaben muss auch eine Rückkopplung kommen, und zwar eine humane von einem Menschen.
Erklärmirnix: Dynamik und Kreativität der Gruppe
Natürlich könnte man sich FC auch so umgesetzt vorstellen, dass keine Videos zu Hause zu schauen, sondern gewisse Aufgaben zur Selbsterarbeitung zu erledigen sind. Warum sollen die Schülerinnen und Schüler nicht zu Hause mit Stäbchen Vierecke legen und diese ordnen? Imre hat jetzt gerade so ein tolles Viereck gelegt, das schaut aus wie aus Starwars und niemand ist da, dem er es zeigen kann, mit dem er drüber reden kann und kein Lehrer ist da, der Imre lobt und sagt, auch das sind Vierecke, nämlich konkave. Schaut mal, der Imre hat konkave Vierecke entdeckt.
Videokiller: Redundanz
Die Vermittlung von Mathematik bedarf gewisser Redundanz. Ein und derselbe Gegenstand muss aus verschiedenen Perspektiven dargestellt und betrachtet werden. Jeder, der schon mal ein Video eines der zahlreich vertretenen Erklärbären auf YouTube etwa zu bestimmten Funktionen von Photoshop angesehen hat, kehrt reumütig zu RTFM zurück: Zu langatmig, zu umständlich, zu wenig auf den Punkt. Redundanz und Video passen nicht zueinander. Mathematikvermittlung demgegenüber braucht Redundanz … .
Zusammenfassung
Der Autor hält FC für den Mathematikunterricht insbesondere der S1 für weitestgehend ungeeignet.
Epilog: Thüringen
Mit dem Computern haben wir Werkzeuge für den Matheunterricht, die weit über das hinausgehen, was wir uns vor Jahren hätten vorstellen können. Natürlich sind das immer noch keine Nürnberger Trichter, aber wir haben jetzt Experimentierumgebungen im Matheunterricht. In den 80ern stand in jedem zweiten Artikel zum Rechnereinsatz im Matheunterricht ein Zitat aus Gödel, Escher, Bach von Douglas R. Hofstatter :
„Der Computer ist ein Maggelan’sches Schiff, das uns zu neuen mathematischen Welten trägt.“
Es wäre schön, wenn wir uns daran wieder erinnern würden. Bezüglich der materiellen Voraussetzungen sieht es heutzutage wesentlich besser aus als in den 80ern.
Die Krone der Rostbratwürste sind natürlich die aus Thüringen. Wer etwas auf sich hält, grillt echte Thüringer. Die müssen nun wiederum auf Holzkohle gegrillt werden. Jedes Jahr zu Ende des Sommersemesters veranstaltet das Fach Mathematik an der PH Heidelberg das große Sommergrillen. Die Studentinnen und Studenten kommen aus der bösesten aller bösen Klausuren, feinstes Klosterbier vom Fass ist eingeschenkt, echte Thüringer warten auf die ersten Abnehmer. Leider hat unser bisheriger Lieferant aus Thüringen sein Geschäft aufgegeben. Wir suchen jemanden, der uns 170 echte Thüringer Rostbratwürste am 28. Juli 2017 zuschickt. Die Thüringer sollten weder gebrüht noch tiefgefroren sein. Natürlich müssen sie gekühlt sein. Dass so etwas geht, zeigte unser früherer Lieferant. Wer weiß Rat?

Der Autor am Grill beim großen Sommergrillen des Faches Mathematik.